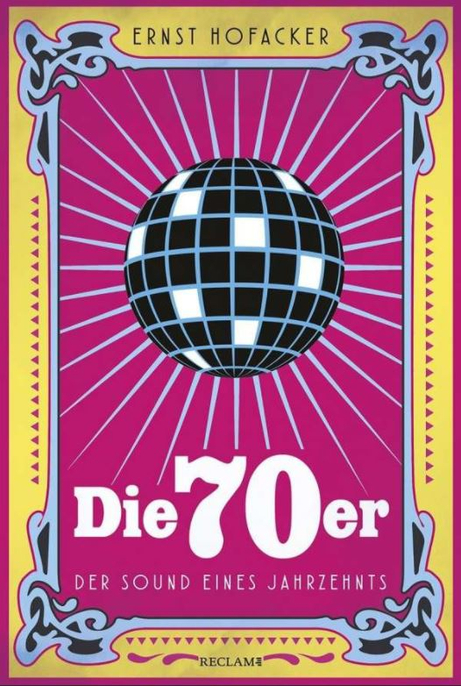
Die 70er. Der Sound eines Jahrzehnts
Reclam Verlag: Ernst Hofacker- Die 70er. Der Sound eines Jahrzehnts € 28.-
Belfast, März 1971: Bomben und Bürgerkrieg, Sicherheit ist nicht garantiert, doch das Konzert in der Ulster Hall findet statt. Das Publikum erwartet harten Bluesrock und wird nicht enttäuscht, auch nicht von einem unbekannten Stück der noch nicht veröffentlichten vierten LP der Gruppe. Doch der sechste Titel beginnt ruhig, der Gitarrist „zupft eine zarte, abfallende Akkordfolge. Die ersten gehen ein frisches Bier holen. Oder pinkeln. Sie sind nicht hierher gekommen, um Balladen zu hören.“ Das Lied nimmt langsam Fahrt auf. „Nach den acht Minuten gibt es artigen Applaus, nicht eben überschwänglich, immerhin aber anerkennend. Die Live-Premiere des neuen Songs darf also als geglückt gelten…“.
Stell Dir vor, es findet Rockgeschichte statt und niemand hört richtig hin, gespielt wurde da Stairway to heaven. Viele weitere Aufhänger, mit denen Ernst Hofacker jedes einzelne Jahr in seinem musikalischen Siebziger-Portrait beginnt, litten ebenso unter mangelnder Wahrnehmung. Der heute legendäre „Gig, that changed the world“ der Sex Pistols in Manchester 1976 fand vor fünfzig Zuhörern statt (und es ist nicht überliefert, wie viele zum Pinkeln den Saal verließen). Die Zahl der noch zurechnungsfähigen Zuschauer zu später Stunde nach zermürbendem Sendungsverlauf beim ORF, als Nina Hagen einen der größten TV-Skandale des Jahrzehnts veranstaltete (She would get some satisfaction, and she tried, and tried, and tried,…tried,…tired), lag wohl kaum höher. Neil Young dagegen, Meister des social distancing von je, war dreißig Minuten (inklusive Hin- und Rückweg in den Wald) ganz allein mit seiner Gitarre, nachdem Graham Nash ihm eine Zeitschrift mit ikonischem Foto vor die Nase hielt und kehrte mit fertig komponierten „Ohio“ zurück. CSNY verdrängten damit Teach your children vom Spitzenplatz der Charts.
Es gilt eben nicht nur der schöne Satz aus dem Vorwort des Bandes „Man kann Smoke on the Water nicht ein zweites Mal zum ersten Mal hören“, sondern genauso die gegenteilige Einschätzung, dass man vieles erst beim zweiten Hören zum ersten Male hört. Was allerdings der in besagtem Vorwort zitierte Journalist des Melody Maker bei der Dark Side of the Moon- Uraufführung hörte, wo er sich wie im Vogelkäfig des Londoner Zoos fühlte, ist mir schleierhaft. Addiere ich die Vogelstimmen der Platte und zähle konzilianterweise die Tierstimmen dazu, bleibt als Ergebnis die Mathematik-für-Anfänger Zeile aus Beethovens Fidelio: Wenn sich nichts mit nichts verbindet, ist und bleibt die Summe klein.
Hofacker kommentiert nicht, sei`s drum- das Einleitungskapitel deutet die später sich entfaltenden musikalischen, gesellschaftlichen und geschichtlichen Qualitäten des Buches sowieso nur vorsichtig an.
Bevor die gewürdigt werden werden, sei noch ein Spaß erlaubt. Man lese die klugen Analysen über das Jahr 1970, wo nach dem Kent State University-Massaker, das Young in Töne goss, im Gegensatz zu den Nixon-freundlichen Carpenters, die dessen Seele früher als der wütende Kanadier entdeckten, eine introvertierte Hippie-Gesellschaft mit freier Liebe, freundlichen Nixen und Toleranz für alleinerziehende Mütter beschrieben wird, deren haufenweise talentierte Musiker „Leute wie Du und ich“-Ausstrahlung haben, und blättere dann kurz weiter zu den Herren Bowie, Pop und Sweet. Zusammenfassungen können jahrimmanent (falls es dieses Wort nicht gibt, jetzt existiert es) plausibel und trotzdem von kurzer Dauer sein.
Oder mit gegenteiligen Entwicklungen sich überlappen bzw. sie herausfordern.
Mitte des Jahrzehnts findet sich schwarz-weiße Zusammenarbeit zwischen Marley und Clapton bei jeweils latentem Rassismus plus haarsträubender Weltanschauung, gefolgt von gepflegter identitätstiftender Unterhaltungs-Show mit Soulmusik und farbigem Moderator, die Paradiesvögel wie David Bowie und Elton John einlädt, und Aufbegehren und Rückbesinnung auf Drei-Akkord-Songs, die in zwei Minuten zu Ende sind, von der nachwachsenden Generation gegen die versnobten Älteren, die ihrerseits erst Mitte zwanzig sind. Hier ist der Autor musikalisch, sprachlich und argumentativ restlos überzeugend und erfreut mit anekdotischem Gespür und geschichtlichem Hintergrundwissen. Noch eine Nummer gelungener sind die Jahre 77/78 mit Extrem-Gegensätzen und Grautönen.
Zunächst die Geburt der Disco aus dem Geiste der Dekadenz im Tempel der Wollust und der Superreichen (Anwesend: Donald Trump). Der Einzug Bianca Jaggers bei der Eröffnung hoch zu Ross hatte zur Folge, dass die rigiden Türsteher bei Nachahmungsversuchen das Pferd passieren ließen, nicht aber die Reiterin. Es wurde gekokst, gehurt und getanzt, gerne alles gleichzeitig. Aber: Toleranz für verschiedene sexuelle Orientierungen wurde großgeschrieben.
Dann die Geburt des Raps aus dem Geiste des Die-Jungen-von-der-Straßeholens in der Bronx mit kreativen DJ`s und friedlichem Islam. Die Technik des Scratchens hatte zur Folge, dass die angeschlagene Schallplatten-Industrie ein kurz- wie langfristiges Hilfsmittel zum Überleben dargereicht bekam. Aber: Die Texte und Ideale waren voller Chauvinismus (Anwesend: Donald Trump- was macht der eigentlich heute?).
Neben den Konflikten zwischen schwarz und weiß, reich und arm, zieht sich auch der zwischen Mann und Frau durch das ganze Buch. Der Eindruck, dass die Feminismus-Sympathien des Autors mit der Attraktivität der praktizierenden Feministinnen zusammenhängen, lässt sich nicht gänzlich leugnen.
Und noch ein Kontrast wird beleuchtet: Deutschland West und Ost und die Suche nach internationalem Anschluss. Die DDR ist mit einigen Gruppen vertreten, aber die Teilnehmer einer Beat-Demo wandern in großer Zahl in den Braunkohletagebau. Wie demokraatsch (E. Honecker) ist das denn? Der Westen ist, wenn auch mit unpräzisen Titelangaben im Fernsehen, mangelnder Pressequalität und im Durchschnitt nicht konkurrenzfähigen Gesangskünsten unbeholfen, etwas weiter und hat mit Udo Lindenberg (langjähriger Inhaber der Lederjacke von E. Honecker) ein von E. Hofacker glänzend beschriebenes Unikum. Erst in den neoliberalen Achtzigern kommt der Kulturschaffende in der BRD aber eine Künstlersozialversicherung, wenige Jahre nachdem der Deutsche Mann seiner Gattin nicht mehr verbieten durfte, arbeiten zu gehen. Kurz vor dem Ausblick auf das folgende Jahrzehnt gelingt Hofacker auf Seite 276 zum Thema Hip-Hop eine Einschätzung, von deren Souveränität und Kontextualität die wissenschaftliche Geschichtsschreibung lange Zeit in Bezug auf Hochkultur-Themen nur träumen durfte. Und die musikalische und gesellschaftliche Handreichung des letzten Jahres der Siebziger in die nahe Zukunft verrät einen belesenen Verfasser. Dennoch setzt er den Schlusspunkt nicht mit dem Album, das, geschmacksunabhängig, symptomatisch für das Ende des wohl kreativsten Jahrzehnts der Rockgeschichte steht, und dessen Umsetzung auf der Bühne mit den Kennzeichen der Achtziger in diese hinüber wies (Und die zwei späteren Sex-Pistols-Mitglieder, die 1972 Bowies Ziggy-Stardust-Equipment nach dem Konzert klauten hätten sich hier gewaltig verhoben.): Hatte nicht jemand die Absicht, eine Mauer zu errichten?
Je, je, je (Copyright: Lennon/McCartney; Aussprache: Walter Ulbricht).
Rezension: Frank Rüb, Oktober 2020